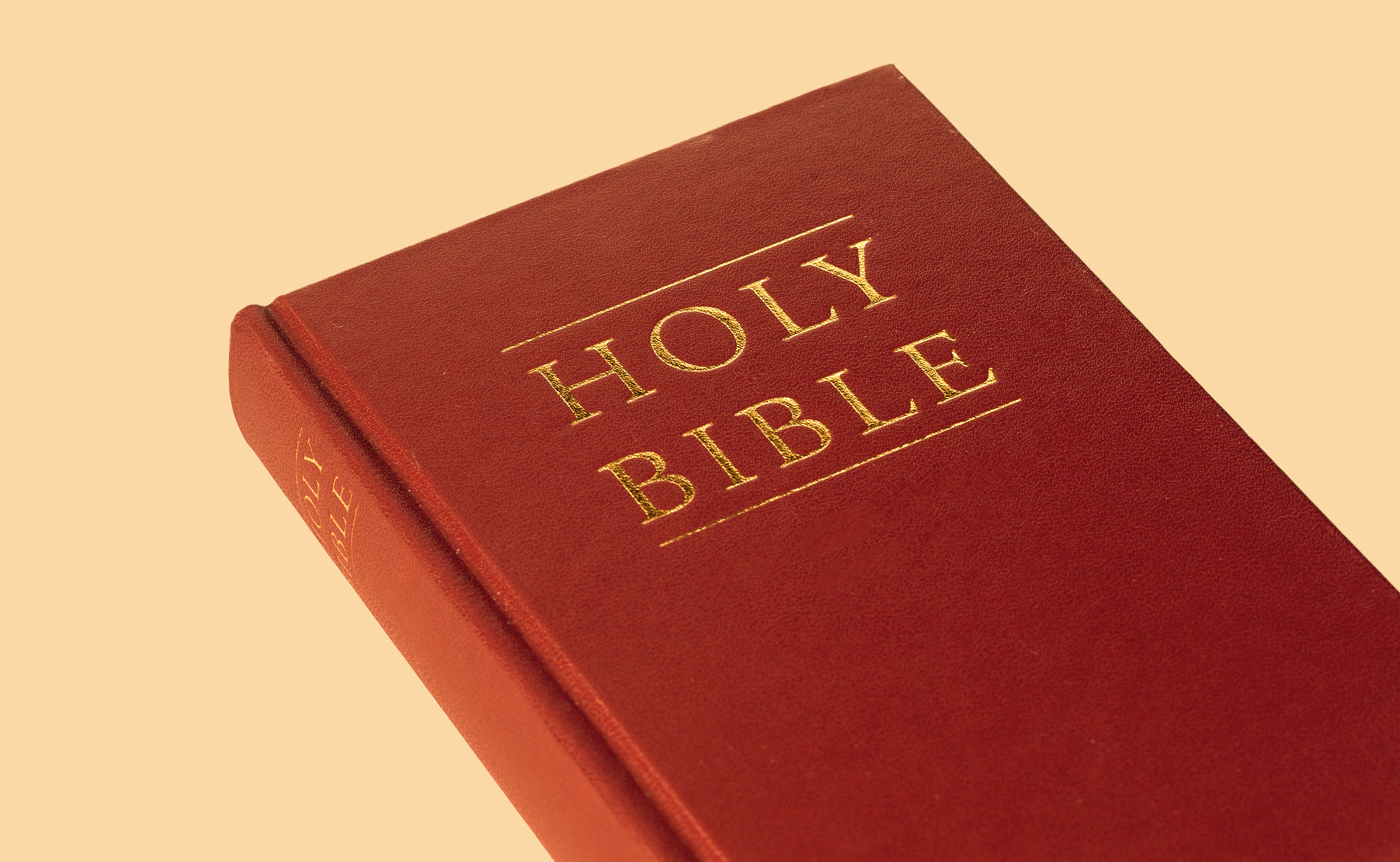Wird von Beratern gerne als erstes und von Inhaber häufig als letztes durchgeführt. Kunden, Produkte oder ein anderes Untersuchungsobjekt werden anhand individuell auszuwählender Kriterien in Gruppen (A-,B-C-,…) klassifiziert. Die Kriterien sind häufig: Umsatz, Deckungsbeitrag, Umsatzpotenzial, Kauffrequzenzen,…..
Ziel ist es, herauszufinden, welche Kunden/Produkte/…. für das Gros des Kriteriums (Umsatz, Marge, etc) ausmachen, um hieraus abzuleiten, welche Ressourcen (Betreuungskapazität, finanzielle Mittel) wohin fliessen sollten, was aber von Geschäftsleitung dann mit fadenscheinigen Begründungen auch gerne anders gemacht wird.
Ein häufig auftretendes Merkmal ist das Prinzip 80_20, welches symptomatisch darstellt, dass nur wenige Kunden für die überwiegende Mehrzeit von Umsatz/Marge/etc. verantwortlich sind. Dies nennt sich dann Klumpenrisiko und wird ebenfalls gerne ignoriert.
Wird gerne mit Verkaufsförderung in einen Topf geschmissen, unterscheidet sich aber durch die Auswirkung auf die Menge. Bekanntestes Beispiel ist der Senfgläserkauf von Herr Lohse in Loriots “Pappa ante portas”. Alltagsbekannte Beispiele sind Aktionen wie “Zahle 2, erhalte 3”. Der Kunde erhält einen Preisvorteil, das Unternehmen setzt quantitativ mehr Produkte ab, dafür jedoch mit niedrigerer Marge (vgl. -> Marge oder auch -> Deckungsbeitrag).
Auch so bezeichnen wir uns von SAMASYS und unsere Dienstleistung.
Im Kontext der konventioneller Vertriebssysteme rechtlich und wirtschaftlich selbständiger Unternehmer, der Geschäfte auf eigenen Namen
tätigt (vermittelt), aber kein Eigentum an der Ware erwirbt (fremde Rechnung). Beispiele sind Handelsvertreter und -Makler, Kommissionäre, aber auch Reisebüros, Agenturen, etc.
Eine wg der vermeintlich rechtlichen Komplexität oftmals gemiedene Weise, fixkosten-light die eigene Vertriebstätigkeit zu erweitern. Aus Sicht von Vertriebsleiter grundsätzlich eher semi-beliebte Variante, wenn beispielsweise Kundenberatung von hoher Relevanz.
siehe auch Absatzhelfer
Link auf einer Partner-Website, um potenzielle Neukunden auf die eigene Homepage zu bewegen. Unterschied zu Bannerwerbung durch andere Abrechnungsmodelle und stärkere inhaltliche Integration.
(vgl. auch Bordstein-Talk): dient dem Aussendienst vor allem dazu, die eigenen Führungskräfte vor Peinlichkeiten in Gegenwart des Kunden zu bewahren. Offiziell, um unmittelbar vor Kundenbesuchen wird der Vorgesetzte durch den Außendienst-Mitarbeiter über die Meeting-Inhalte gebrieft, unmittelbar nach dem Kundenbesuch erteilt die Führungskraft Spontan-Lob oder -Kritik. Gerne auch missbraucht, um im Kollektiv Unmut über den gerade versauten Kundentermin loszuwerden.
Branding (zu deutsch in etwa „Markenführung“) löst zunehmend den Begriff Corporate Design ab bzw. wird oft synonym verwendet. Hier wie dort geht es darum, mit den Mitteln von Design (und anderen) eine Unternehmensmarke – diese kann auch das Unternehmen selbst meinen – sichtbar, eigenständig und positiv erlebbar und sie damit “begehrenswert” zu machen, wobei sich Branding nicht nur auf visuelle Elemente beschränken muss.
Erfindungen, die die Menschheit sich bis zur finalen Reife sparen sollte. Chatbots (oder auch Social Bots) sind Softwareroboter, deren Kernaufgaben das “liken”, “retweeten”, “Texten” oder, als Chatbots mit natürlichsprachlichen Fähigkeiten ausgestattet, das “kommunizieren” ist. Begegnen einem oft bei dem Besuch von Webseiten, wenn von unten rechts des Bildschirm wie aus der Pistole geschossen ein Dialogfenster aufgeht, in dem eine “Ana”, “James”, “Mike” oder ähnlich kurz geschriebener Name, teilweise mit Abbildung eines Mittzwanzigers unmittelbar im Dutz-Jargon anspricht, ob er/sie einem helfen könnte. Und glücklicherweise durch einen Mausklick wortwörtlich “gelöscht” werden kann.
Oftmals wird ein Logo von einem Claim/einer Tagline begleitet: ein kurzer Satz, der den Kern der Marke unterstützt und emotionalisiert (“ich liebe es”, “Erleben, was verbindet”, “Sind sie zu stark, bist Du zu schwach”). Beides wird synonym verwendet, wobei der Begriff Claim in der deutschen Werbewelt gängiger ist.
wortwörtlich übersetzt: das “Ködern von Aktionen mit der (Computer)Maus”. Grausige Angewohnheit von Möchte-Gern-Journalisten, ihrer vermeintlichen Zielgruppe die Leseintelligenz absprechenden Bloggern und Aufmerksamkeits-geilen Influencern, durch plakativ-reißerische, oftmals irreführende Textüberschriften die Click-Rate und danach den Puls vermeintlich interessierter Leser in die Höhe zu treiben. Hier wäre dringender Handlungsbedarf des deutschen Werberates gefragt, aber die sind ja mit anderen, “großen” Themen beschäftigt (vgl. Deutscher Werberat)
Die Click-Through-Rate (Abk. CTR oder “Klickrate”) ist ein quantitativer Messwert des Online-Marketings. Sie gibt an, wie oft auf ein Element (beispielsweise ein Werbebanner, Sponsorenlink oder Suchergebnis) geklickt wurde und ins Verhältnis gesetzt zu der Anzahl der Impressionen (oder Aufrufe) dieses Elements. Wenn ein Element beispielsweise hundertmal angezeigt wird und dabei einmal angeklickt wird, beträgt seine Klickrate 1%. Ob das dann gut ist oder schlecht, dazu braucht es dann wieder einen Berater.
| Lieblingstätigkeit von gelangweilten Produkt- oder Business Development-Manager, gerne auch im Doppel mit den Vertriebsabteilungen von Spartenorganisationen. Und zusätzlich angeheizt durch ahnungslose First-Level-Support- und ausgelagerte, motivations-befreite Customer-Service-Abteilungen. Ziel der CC scheint zu sein, potenziellen Interessenten sowie Bestandskunden mehr Fragen aufzugeben als zu beantworten. |
Ein “Content Piece” ist wie ein Chamäleon auf einer Kostümparty – es passt sich perfekt an seine Umgebung an, sei es ein tiefgründiger Blogartikel, ein dahingerotzter Post, ein brauchbares Erklär-Video oder philosophisch-abschweifende Podcast-Folge. Es ist das Schweizer Taschenmesser der digitalen Kommunikation: oft vielseitig, meistens nützlich und manchmal schwer zu finden, wenn man es am dringendsten braucht.
Im Marketing bezeichnet der „die Conversion“ die Umwandlung eines Webseiten-Besuchers in einen Interessenten, eines Interessenten in einen Kunden….etc.. Sie stellt dar, wie viele Interessierte, Leads, Prospects, …..Menschen etc. einer durch das Marketing gewünschten Handlung gefolgt sind. Dies kann beispielsweise der Kauf eines Produkts, das Abonnieren eines Newsletters oder das Ausfüllen eines Kontaktformulars sein.
Die Conversion-Rate gibt den Prozentsatz an, die der gewünschten Aktion gefolgt sind. Die Berechnung anhand eines einfachen Beispiels: die Webseite hat in der vergangenen Woche 1000 Webseiten-Besuche gehabt. Davon haben 50 Besucher das neue Whitepaper heruntergeladen. Dann wäre – bezogen auf dieses Whitepaper und die vergangene Woche – die Conversion-Rate = 5 %.
Wird von vielen Nicht-Marketeers oft falsch (oder gar nicht) interpretiert, ist aber ein wichtiger Indikator für die Effektivität von Marketingmaßnahmen. Und hilft Unternehmen zu verstehen, wie gut ihre Strategien funktionieren und wo Optimierungsbedarf besteht.
Als Corporate Design wird landläufig das Zusammenspiel aller visuellen Elemente einer Unternehmenskommunikation bezeichnet: Das Logo und der Claim, Schriften, Farben, Bildsprache, Illustrationen, Infografiken, Texte („Wording“) usw. Das Corporate Design ist ein Teil der Corporate Identity, die die Leistungen, das Selbstverständnis, das interne und öffentliche Auftreten eines Unternehmens auf allen Ebenen umfasst – dazu gehört z.B. auch der Jingle eines Telekommunikationsanbieters oder, derzeit sehr en vogue, publik gemachtes soziales Engagement.
Buzz-Wort, welches primär von Nicht-im-Vertrieb-tätigen inflationär verwendet wird, aber in 9 von 10 Anwendungsfällen nur heiße Luft nach sich zieht. Originär als Bezeichnung für Maßnahmen, die zum Ziel haben, bestehenden Kunden zusätzlicher Produkte zu verkaufen, die bisher nur an andere Kunden veräußert wurden (und vice versa). Auf Entscheider-Ebene auch gerne genutzt, um Zeit zu gewinnen, bis einem smartere Ideen für Wachstum einfallen.
Freiwillige Selbstkontrolle der deutschen Werbewirtschaft gegen missbräuchliche Werbung. Bei genauerer Betrachtung ein zahnloser Ü-50 Club von sich selbst beweihräuchernden, chronisch Espresso-oder-Cognac-trinkenden Vertretern aus Großkonzernen, die sich seit neustem mit Verstößen gegen Gendern und ähnlichen, großen Themen des 21. Jahrhunderts befassen (dürfen).
Der Dreisatz ist ein in der Sekundarstufe 1 (5.-7. Klasse) gelehrtes, mathematisches Verfahren, mit dem man aus drei gegebenen Werten den vierten, unbekannten Wert berechnen kann, wenn zwischen den Größen eine proportionale Beziehung besteht. Es wird häufig verwendet, um einfache Proportionalitätsprobleme zu lösen.
Böse Zungen behaupten, dass bei ordnungsgemäßer Anwendung in der deutschen Wirtschaft 2/3 der Unternehmensberater-Riege über Nacht arbeitslos würden. Und das ist vermutlich noch sehr konservativ gerechnet.
Auf der Ebene des Contents mehr oder weniger der Kontrast zu allem “anderen” Marketing: Marketing mit Substanz. Der (wer hätte das gedacht) aus dem engl. sprachigen Raum importierte (Unter)Begriff des Marketings beschreibt eine Tendenz, kostenfreie Inhalte in Form von Fallstudien, Ergebnisse einer Um- oder Befragung, Analysen eines spezifischen Problems oder Anwenderberichte in “nicht-werblicher” Sprache und Ausdrucksweise zu beschreiben, Allerdings nicht ganz kostenfrei: die Inhalte werden meistens um Tausch gegen Email- und Kontaktdaten eingetauscht. Vermutlich einer der Gründe, warum selbst im 21. Jahrhundert noch so viele neue Emailaccounts (kurzzeitig) angelegt werden.
| Bösartig interpretiert: die Mitarbeiter als sekten-artige Anhänger alles “Positive” über die Firma nach außen tragen zu lassen, um ein der eher eingeschränkten Realität entsprechendes Image zu transportieren. Offiziell als Teil der Markenkommunikation: jeder (frei)willige Mitarbeiter wird in die Verbreitung von durch die PR-/Öffentlichkeitsabteilung eines Unternehmens erstellten Presse-/Ad-hoc-Meldungen, Kurznachrichten, Social Media-Posts, Blogbeiträgen, etc… eingebunden und kann diese in seinem persönlichen Netzwerk und Bekanntenkreis kundtun und kommentieren. Nannte sich früher Mundpropaganda, benötigte aber aus Zeitgeistgründen eine neue, weniger nach Propaganda klingende Bezeichnung. |
Die gekühlte Cola im Kühlregal neben der Supermarktkasse, das Premium-Pflegeshampoo beim Friseur, der Hotdog nach der Ikea-Kasse, ….die Liste ist schier endlos. Zuletzt wurde sogar der Erwerb von Twitter durch Elon Musks als Impulskauf” tituliert. Allen gemein: der Kaufakt ist nicht rational geplant, sondern genau das Gegenteil. Er wird getriggert durch besondere Platzierung (im Einzugsbereich der Kasse oder des Ausgangs), durch spezielle Preisvorteile, durch zeitliche Limitierungen, durch Gestaltung von Atmosphäre und Sonderverkaufsständer. Retailer und Konsumgüter-Hersteller machen Sie das regelmäßig zunutze, um den Durchschnittsbon zu erhöhen. Im b2b- Bereich noch nicht durchgängig präsent, aber auch hier sind bei Firmen mit eigenem Online-Shop und funktionierendem CRM dabei, die Logik für sich zu nutzen, z.B. durch intelligente Warenkorbanalysen und Online-Ads.
Ein bekanntest Zitat lautet: wer erfolgreich sein will, muss verstehen, wo und wie die Probleme seiner (potenziellen) Kunden gelagert sind, d.h. er muss den Faktor kennen, der bei seiner Klientel den Kittel in Brand setzt: was setzt den vermeintlichen Ansprechpartner jetzt oder demnächst unter Druck, was verursacht ihm/ihr Stress, was stellt ihn aktuell (oder demnächst) vor Herausforderungen? Wenn dies bekannt ist, können gezielte Argumentationen (oder Angebote) vorbereitet und frühzeitig im Dialog vorgebracht werden (-> vgl Sales Pitch).
Die Hälfte der dt. Vertriebler kennt das Prinzip, aber nur ein Bruchteil handelt auch danach (-> vgl. Kundenbearbeitungspläne)
Wird in der Analyse von Kunden und deren “Mehrwert” für das Unternehmen viel zu häufig NICHT angewendet. Aus Angst vor bösem Erwachen? In Echt: bivariates Verfahren, um den Zusammenhang zwischen zwei intervallskalierten bzw. metrischen Variablen miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel zwischen dem Umsatz- oder Mengen-Volumen eines Kunden und dem korrespondierenden Deckungsbeitrag.
| “There is no brand loyalty that 2 cent off can’t overcome” – dieses Zitat eines amerikanischen Marketing-Gurus sagt alles aus. Fast alles. Es gibt auch Ausnahmen, z.B. beim örtlichen Automechaniker, beim Bäcker und Metzger des Vertrauens, beim kleinen, Inhaber-geführten Mitteständler. Ab einer gewissen Größenordnung darf ein Unternehmen angesichts ausgelagerter Telefonhotlines und und mit ausländischem Akzent sprechender Kundenservice-Teams keine Loyalität seitens seiner Kunden mehr erwarten, weshalb die Neukundenakquise-Maschinerie auch so gut geschmiert sein muss. |
Das Zeichen für dein Unternehmen/Produkt/Projekt. Ein Logo kann ein einfacher Schriftzug sein, ein Signet (Zeichen) oder eine Kombination aus beiden („Wort-Bild-Marke“ ist ein oft dafür verwendeter Begriff).
| Ein Wortspiel, bestehend aus dem engl. “list” und “article”. Das Darstellungsformat eines Artikels, welcher maßgeblich aus Aufzählungen von Punkten besteht und als Format häufig in Blogs oder Posts zu finden ist. Das Format soll dem Leser Lesefreundlichkeit stiften und suggeriert, dass jedes Problem, jeder Sachverhalt und jedes Erfolgskonzept dieser Welt auf 3, 5, 9 oder manchmal auch 12 “Punkte” reduziert werden kann. |
Marge – ein Begriff aus der Betriebswirtschaft, den der Vertrieb gerne ignoriert und von dem Marketing-Abteilungen gerne unterstellen, dass er eine Erfindung des Controllers sei, um sie zu ärgern. Ganz grob: der Abstand zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis – quasi das finanzielle Polster, das sicherstellt, dass nach dem Verkauf nicht nur die Kosten gedeckt sind, sondern auch noch was im “Kaffee-Kässchen” bleibt.
Wird von der eigenen Marketing-Abteilung und dem eigenen Management häufig über-, von vielen Außenstehenden gerne unterschätzt, von Investoren gerne mal vernachlässigt, von solventen Serienunternehmern auch gerne wiederbelebt. Denn vor allem Marken-affine Entrepreneure wissen, dass “Marke” nicht nur sehr belastbar, sondern vor allem einen sehr hohen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. Negativbeispiele in D für Imageverschlechterungen sind u.a. Quelle, Grundig, Air Berlin, Kettler oder Schlecker. Als Positivbeispiele für erfolgreiche Image-Wiederbelebungen dürfen beispielsweise Märklin Modelleisenbahnen, Afri Cola oder die Uhrenfabrik Junghans gelten.
Lateinisch für propagere: weiter aus-/verbreiten. Seit historisch umwälzenden Ereignissen negativ besetzt, da es das Vorgehen beschreibt, politische oder gesellschafts-öffentliche Sichtweisen zu formen und dabei auch vor Manipulation nicht zurückschreckt. Wird in Vermarkungszwecken zur Umsatzsteigerung gerne verharmlost, wobei sich das Vorgehen weder moralisch noch inhaltlich von der politischen Anwendung unterscheidet.
Neudeutsch für die Essenz eines guten Verkaufsgesprächs. Der gesunde Menschenverstand würde unterstellen, dass die Bausteine 1. gründliche Vorbereitung und Herausarbeiten eines Aufhängers (“wo drückt meinen Gegenüber der Schuh”), 2. Kontext herstellen (warum kontaktiere ich den Kunden, welchen Mehrwert biete ich ihm, prägnante Darstellung des Vorteils, der sich aus der Zusammenarbeit ergibt), 3. Handlungsaufforderung (wie und wann wird das Gespräch fortgesetzt, welche Informationsbedarfe sind noch offen, etc.) selbstverständlich sind. Sind sie aber nicht, weswegen Menschen wie wir bei Samasys eine Existenzberechtigung haben.
Etwas missverständliche Bezeichnung, da es nur indirekt um “Verkaufen” geht. Eine treffende Definition, die sich auf der Seite eines CRM-Anbieters findet: “Social Selling ist keine Social-Media-Werbung. Und auch kein Social-Media-Marketing. Es geht um die Praxis der Beziehungspflege auf digitalen Kanälen mit dem Ziel der Kontaktanbahnung und Dialogaufbau. Kurz gesagt: weniger Anpreisen, mehr Konversation.” Wird von manchen Beratern als schnelles Allheimmittel angepriesen, um Leads zu generieren. Auf ein Bonusmodel lassen sich diese Berater allerdings meisten nicht ein. Ein Schelm, wer hier Zusammenhänge sieht.
Der Glaube seitens der Hersteller bzw. Marken, durch vermeintliche “Produkt-/Vertrags-Vorteile” langfristige Kundenzufriedenheit zu schaffen, in Wirklichkeit jedoch vor allem die Abwanderung des Kunden erschweren soll. Im Mittelstand noch immer sehr stiefmütterlich gehandhabtes Konzept, dass auch oft durch fehlenden Glauben an die eigene Produktqualität begründet ist. Im Konzern-Segment geläufiges Beispiel ist Apple, hier stellt allein die fehlende Kompatibilität des Apple-Systems zu anderen Systemen eine große Hemmschwelle dar. Die Anbieter von Telefondienstleistungen oder Fahrzeugleasing-Gesellschaften erreichen das gleiche Ziel über lange Vertragslaufzeiten. Um die potentielle Unzufriedenheit dieser durch den Kunden meist erst nachträglich empfundener In-Flexibilität zu kompensieren, werden diese durch die Anbieter mit vermeintliche “goodies” versorgt, z.B. durch Sach-Prämien (Versicherungen, Mobilfunk, Energie-Dienstleister) oder durch Preisvorteile (Energie-Dienstleister, Fitness-Studios, Versicherungen).
Neuer Wein in alten Schläuchen: bezeichnet die Taktik des Vertriebsmitarbeiters, den (potenziellen) Kunden den Mehrwert seines Angebots plastisch vor Auge zu führen und die Unterschiede zu vermeintlich günstigeren Angeboten plakativ hervorzuheben. Ein geschulter Vertriebler tut dies intuitiv, wenngleich viele im Vertrieb tätigen Menschen noch immer die Vorteile und Vorzüge des eigenen Produktsortiments entweder unzureichend in Ihre Kommunikation mit aufnehmen oder zu wenig auf die Bedürfnisse des Gegenübers anpassen.
| Umfasst in der landläufigen Auffassung die Schritte der Planung, des Messens, des Analysierens und Auswertens sowie des Bewertens sämtlicher Vertriebsaktivitäten und ermöglicht so das anschließende Steuern und Eingreifen. Die vollständige und konsequente Schrittabfolge wird in der Mehrzahl der deutschen Mittelständler häufig eingeschränkt oder mit Brüchen praktiziert. Sehr oft zu beobachten ist, dass das Controlling zwar Daten zur Auswertung liefert, aber diese (noch!) zu selten zur Ableitung konkrete Maßnahmen genutzt werden. Deutlich beliebter ist hingegen spontaner Aktionismus in Form von schnell anberaumten ad-hoc-Kampagnen oder Preis-Maßnahmen, um sich beim nächsten Reportingzyklus gegenseitig betroffen, aber mit dem Gefühl des “immerhin haben wir es probiert” in die Gesichter zu schauen. |
Der Versuch des Marketing, die Wertigkeit eines Produktes/Servicedienstleistung durch viel werbliches Gedöns künstlich zu erhöhen und das (im Vergleich zum Wettbewerb höhere) Preisniveau zu legitimieren. -> Vgl. auch Value Added Selling.
Bei einzelnen Produkten, vor allem aus dem Premium-/Luxusgüter-Segment, erhärtet sich zunehmen der Verdacht, dass der Grundnutzen durch den Zusatznutzen schon längst in den Schatten gestellt wurde. So wirbt beispielsweise der Hersteller The Nu+Company damit, dass die Schokoladenriegel (40 gr = € 1,99) vor allem Plastikfrei verpackt, vegan, fairen Handel sicherstellend und klimafreundlich sind und dass der Verzehr konventioneller Schokoladenriegel ab sofort nur noch unter dem Gesichtspunkt “Gewissensbisse statt Leckerbissen” stattfindet. Der Grundnutzen (“leckere Schokoladenriegel”) wird fast schon nebulös nur noch im Hintergrund bespielt.
Weitere Wünsche? Teilen Sie uns weitere Themen mit, die Sie interessieren. Gerne benachrichtigen wir Sie, sobald diese online sind.